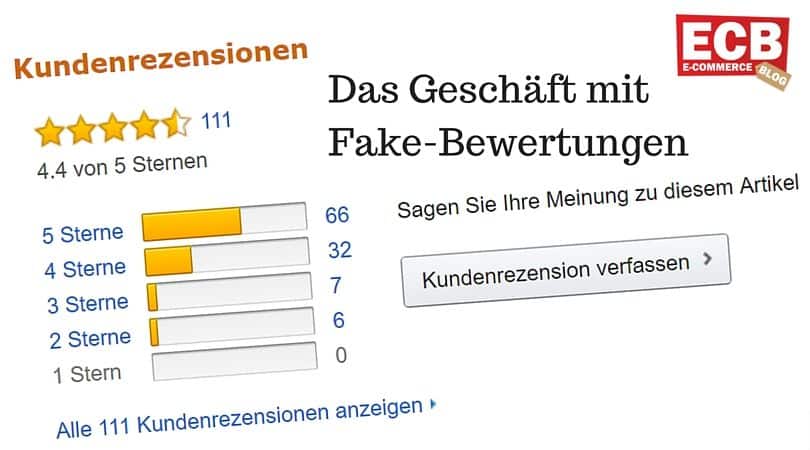Die Verbraucherrichtlinie von 2014 verlangt klar, dass Onlinehändler angeben müssen, wann ihre Ware beim Kunden ankommt oder bis wann eine Dienstleistung erbracht sein wird. Viele Händler versuchen, diese Angabe durch bestimmte Formulierungen möglichst vage zu halten. So wollen sie sich vor Schwierigkeiten durch verspätete Auslieferungen oder Probleme mit den Zustellern schützen. Doch nicht alle relativierenden Formulierungen sind zulässig, weswegen Wachsamkeit bei der Angabe von Lieferzeiten angebracht ist.
Spagat bei Lieferzeiten – zwischen Zuverlässigkeit und Flexibilität
Onlinehändler sehen sich in Bezug auf die Lieferzeiten in einem Spannungsfeld: Zum einen sind sie durch die Verbraucherrichtlinie von 2014 dazu verpflichtet, ihre Kunden über die Lieferzeiten für ein Produkt beziehungsweise die Dauer bis zur Erbringung einer Dienstleistung umfassend zu informieren. Zum anderen wollen sie möglichst flexibel arbeiten und nicht durch falsche Angaben bei den Lieferzeiten angreifbar werden. Deswegen weichen viele Anbieter auf schwammige Formulierungen aus, um sogar Probleme bei der Auslieferung oder Ärger mit den Zustellern ausgleichen zu können. Der Gesetzgeber hat in diversen Urteilen jedoch zahlreiche dieser Formulierungen bereits als unzulässig erklärt. Onlinehändler müssen daher bei der Angabe ihrer Lieferzeiten sehr genau formulieren, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
Diese Formulierungen zu den Lieferzeiten wurden für unzulässig erklärt
Schon häufig haben sich Gerichte mit Relativierungen bei Angaben zu Lieferzeiten beschäftigt. Hierbei hat sich immer wieder gezeigt, dass von den Onlinehändlern ein gewisses Maß an Präzision eingefordert wird. Die Kunden müssen durch die Lieferzeitenangaben in die Lage versetzt werden, möglichst genau einschätzen zu können, bis wann sie ein Produkt in Händen halten oder bis wann eine Dienstleistung erbracht sein wird. Außerdem wird weitestgehende Ehrlichkeit verlangt. Wenn ein Unternehmen bereits weiß, dass es eine Lieferzeit von „2-4 Werktagen“ nicht einhalten kann, ist es ihm untersagt, mit dieser Serviceleistung auf dem eigenen Internetauftritt zu werben.
Versandfertig in …
Ebenfalls nicht ausreichend ist die Formulierung „Versandfertig in …“. Für den Kunden ist aus dieser Angabe nicht abschätzbar, bis wann eine bestellte Ware spätestens zugestellt sein wird. Bei den Lieferzeiten darf die Postlautzeit nicht einfach ignoriert werden. Ebenso ist es unzulässig zu sagen, dass die Lieferzeiten „unverbindlich“ oder nur „auf Anfrage“ zu bekommen wären. Der Gesetzgeber sagt, dass Kunden ein ausdrückliches Recht auf die Angabe von Lieferzeiten hätten, das weder unverbindlich sein noch einen Mehraufwand bei der Bestellung für die Käufer bedeuten dürfe.
In-der-Regel-Zeitangaben
Des Weiteren wurden „In-der-Regel-Zeitangaben“ von verschiedenen Gerichten für unzulässig erklärt. Die Begründung: Diese Formulierung umfasst keine Endfrist, bis zu der die Lieferung spätestens erfolgt sein wird. Ähnliches gilt für „Voraussichtliche Lieferzeiten“, weil diese eine nicht ausreichend präzise Frist für die Auslieferung angeben. Zudem argumentiert das Gericht, dass Kunden bei diesen Formulierungen nicht klar abschätzen können, ab wann eine Dienstleistung erbracht sein muss und ab wann ein Verzug besteht, gegen den rechtlich vorgegangen werden kann.
Zirka-Angaben sind ausdrücklich erlaubt
Eine klare Ausnahme bei den Angaben zu den Lieferzeiten stellen sogenannte „Zirka-Angaben“ dar. Eine Formulierung wie zum Beispiel: „Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Werktage“ stellt der Rechtsprechung zufolge eine ausreichend eindeutige Eingrenzung dar, an der sich die Käufer orientieren können. Eine Abweichung von dieser Angabe ist demnach nur in sehr geringem Maße zulässig. Ebenfalls in Ordnung sind Zeitspannen (2-4 Werktage) oder Höchstfristen (nach spätestens 4 Werktagen). Onlinehändler sollten bei der Angabe von Lieferzeiten möglichst präzise formulieren und Relativierungen vermeiden, damit es nicht zu Abmahnungen und gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Kunden kommt.